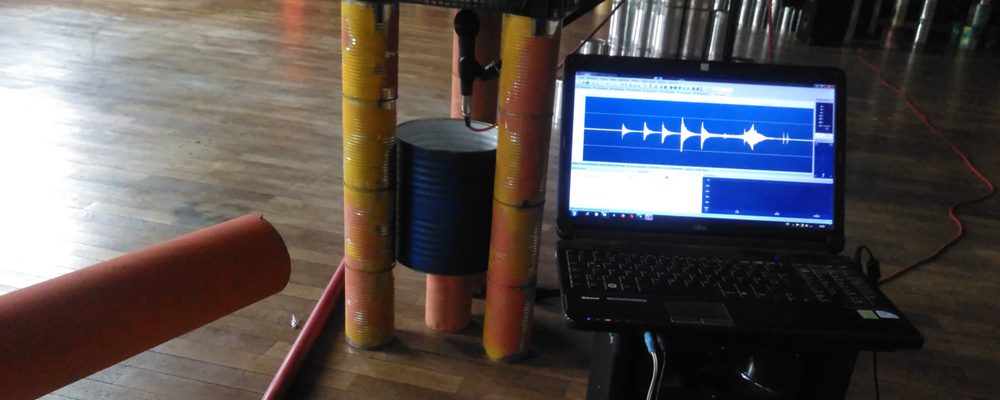Es ist eine Erscheinung, die sich wie ein digitales Unkraut über das Internet gelegt hat: der Linktree. Wer kennt es nicht? Man klickt auf den Link in der Bio eines Künstlers, Musikers oder Influencers und wird nicht etwa auf eine sorgfältig gestaltete, einladende Homepage geleitet, sondern auf eine Seite, auf der Dutzende kleiner Buttons auf dich herabstürzen. YouTube-Kanal, Spotify-Profil, TikTok, Twitter, Instagram, Discord-Server, Telegram-Gruppe – die Liste ist endlos. Man steht vor einem digitalen Baum, dessen Äste ins Nirwana der unendlichen Social-Media-Profile führen.
Der Glaube dahinter ist so einfach wie falsch: Je mehr Links, desto besser. In der Logik des modernen, vom Algorithmus getriebenen Geistes scheint es verlockend, jeden erdenklichen Kanal mit einem Klick zugänglich zu machen. Schließlich muss man ja überall präsent sein, um relevant zu bleiben, nicht wahr? Doch genau betrachtet, ist der Linktree die vielleicht größte digitale Zeitverschwendung der letzten Jahre und ein Paradebeispiel für die Illusion von Effizienz.
Die Irrfahrt zum gleichen Inhalt
Früher, in der goldenen Ära der eigenen Webpräsenz, gab es eine einfache, elegante Lösung: die eigene Website. Dort fand man alles, was wichtig war, an einem Ort: Die Musik, die Termine, die Biografie, die Kontaktdaten und die News. Eine Website war die digitale Visitenkarte, das Hauptquartier, das Schaufenster. Sie war praktisch, effektiv und sinnvoll. Sie bündelte die Energie und die Marke an einer zentralen Stelle, die man selbst kontrollierte und gestaltete.
Der Linktree hingegen schickt dich auf eine verwirrende Irrfahrt. Du klickst dich durch fünf oder mehr Social-Media-Profile, nur um am Ende festzustellen: Überall ist derselbe Inhalt. Der neue Song wird auf Spotify angekündigt, in einem Instagram-Reel beworben, auf YouTube mit einem Video hinterlegt und auf Twitter mit einem scharfsinnigen (?) Tweet begleitet. Und was hat man am Ende? Man hat fünf Mal die gleiche Information konsumiert, fünf Mal Zeit verloren und fühlt sich leicht veräppelt.
Diese Unlogik ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die meisten Linktree-Nutzer ihre eigene Zeit mit dem Abarbeiten dieser Kanäle verbringen. Statt einen hochwertigen Beitrag für die eigene Website zu erstellen, wird der gleiche Inhalt für jede Plattform neu formatiert, mit Hashtags bestückt und in die unendliche Weite der Social-Media-Feeds geschleudert. Es ist eine Sysiphus-Arbeit, die mehr dem Algorithmus dient als dem eigenen Publikum.
Die gefährliche Abhängigkeit und die Hoffnung auf eine Rückkehr
Der Linktree ist nicht nur ineffizient, er ist auch ein Symptom einer gefährlichen Entwicklung: der Abhängigkeit von externen Plattformen. Wer auf einen Linktree setzt, gibt die Kontrolle über seine Marke und seine Reichweite aus der Hand. Er überlässt es Algorithmen, ob die Inhalte gesehen werden, und akzeptiert die AGBs und Regeln von Konzernen, die sich jederzeit ändern können.
Die eigene Website hingegen ist ein Stück digitales Eigentum. Sie ist der Ort, an dem man die Kontrolle über die Daten, das Layout und die Kommunikation behält. Sie ist der sichere Hafen in einem stürmischen Ozean aus sozialen Medien.
Man kann nur hoffen, dass die zielstrebigen und klugen Menschen in der Musik- und Kunstszene diese Erkenntnis wiederentdecken und zurückfinden zur eigenen Website. Dass sie begreifen, dass es nicht darum geht, auf jeder Plattform eine Kopie seiner selbst zu sein, sondern darum, eine starke, zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die den Menschen das gibt, was sie wirklich wollen: einen klaren, unkomplizierten Zugang zur Kunst.
Der Linktree mag für manche die schnelle Lösung sein, aber die nachhaltige, intelligente und respektvolle Art, sich zu präsentieren, ist und bleibt die eigene Website. Sie ist der Leuchtturm, der durch das Meer der endlosen Links navigiert und das Publikum sicher nach Hause bringt.